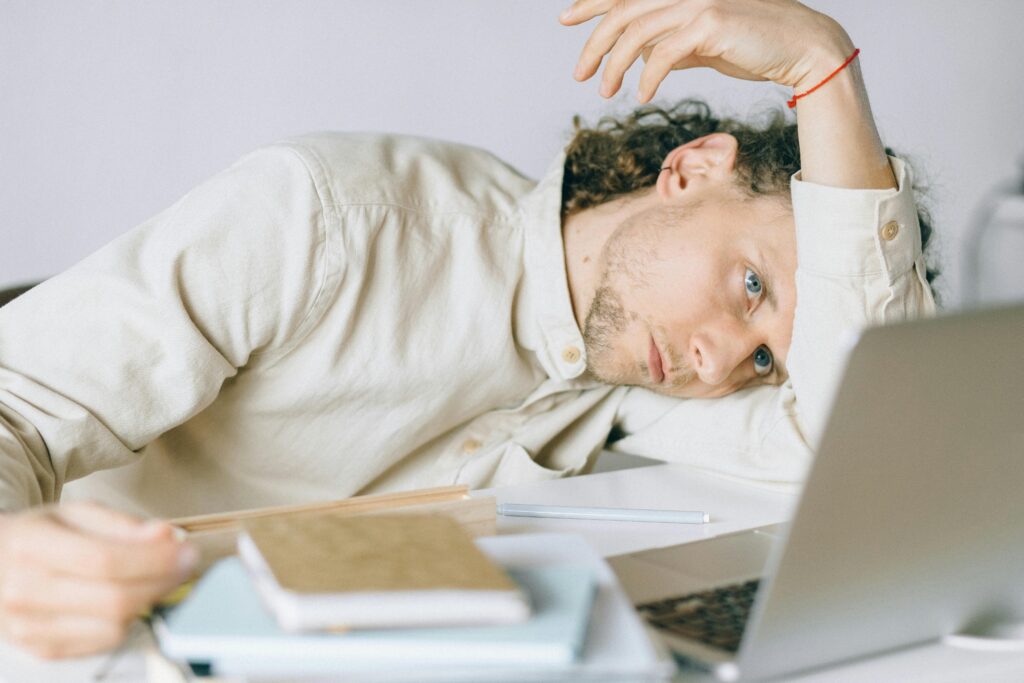
Zwischen Erschöpfung, Engagement und Entfremdung – ein fundierter Überblick
Burnout – kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren so stark an Aufmerksamkeit gewonnen.
Während die einen vom „Ausgebranntsein“ sprechen, erleben andere innere Leere, Zynismus oder einen plötzlichen Leistungsabfall.
Doch was genau ist Burnout eigentlich? Und was ist es nicht?
Was sagt die Wissenschaft über Burnout?
Trotz jahrzehntelanger Forschung ist Burnout bis heute keine eigenständige psychische Erkrankung.
In der ICD-11, dem internationalen Klassifikationssystem für Krankheiten der WHO, wird Burnout als sogenannter Faktor, der die Gesundheit beeinflusst geführt – jedoch nicht als Diagnose.
Das heißt: Burnout kann mit erheblichen Einschränkungen im Alltag einhergehen, ist aber eher ein „Risiko- und Belastungszustand“, nicht per se eine Krankheit.
Eine häufig zitierte Definition stammt von Maslach und Leiter (2016):
Burnout wird definiert als ein Zustand emotionaler, körperlicher und mentaler Erschöpfung infolge anhaltender Stressbelastung, gekennzeichnet durch Zynismus, innere Distanzierung und verringerte berufliche Leistungsfähigkeit.
Die Forschung hat sich weitgehend auf drei Kernmerkmale verständigt:
- Emotionale, körperliche oder kognitive Erschöpfung – Betroffene fühlen sich dauerhaft ausgelaugt.
- Innere Distanz oder Zynismus gegenüber der Arbeit – Der Job wird gleichgültig, sinnlos oder abstoßend erlebt.
- Reduzierte Leistungsfähigkeit – Konzentration, Kreativität oder Motivation lassen deutlich nach.
Diese Burnout-Symptome treten nicht über Nacht auf, sondern entwickeln sich schleichend über Wochen oder Monate.
Burnout – Mythen und Fakten
Mythos 1: Burnout ist einfach nur extremer Stress.
Fakt: Stress kann zu Burnout beitragen, aber die beiden sind nicht dasselbe. Stress ist in der Regel kurzfristig und kann sogar leistungssteigernd wirken – etwa vor einer Deadline oder in Prüfungssituationen. Burnout hingegen ist ein chronischer Erschöpfungszustand, der sich über Wochen oder Monate hinweg entwickelt. Es geht dabei nicht nur um zu viel Stress, sondern um einen Zustand tiefer emotionaler, körperlicher oder kognitiver Erschöpfung, oft begleitet von innerer Distanzierung zur Arbeit (Zynismus) und reduzierter Leistungsfähigkeit.
Mythos 2: Burnout trifft nur Menschen, die nicht gut mit Stress umgehen können.
Fakt: Tatsächlich sind es oft die besonders leistungsstarken, engagierten oder resilienten Menschen, die ein hohes Risiko für Burnout haben. Warum? Weil sie hohe Erwartungen an sich selbst stellen, selten Nein sagen und sich stark mit ihrer Arbeit identifizieren. Sie übersehen frühe Warnzeichen, kompensieren lange Zeit durch Disziplin – bis irgendwann die Energie aufgebraucht ist. Umgekehrt schützt auch Begeisterung für den Job nicht automatisch: Wer liebt, was er tut, läuft eher Gefahr, eigene Grenzen zu überschreiten.
Mythos 3: Burnout ist eine Modeerscheinung.
Fakt: Der Begriff „Burnout“ wurde 1974 von dem deutsch-amerikanischen Psychologen Herbert Freudenberger geprägt. Er beobachtete bei sich selbst und Kolleg:innen in einer New Yorker Klinik zunehmende emotionale Erschöpfung, Zynismus gegenüber der Arbeit und das Gefühl, nichts mehr bewirken zu können. Doch Burnout-ähnliche Phänomene gab es schon früher. Bereits im 19. Jahrhundert wurde in der westlichen Medizin die sogenannte „Neurasthenie“ beschrieben – eine „nervliche Erschöpfung“, die erstaunlich viele Parallelen aufweist. Burnout ist also kein modernes Medienphänomen, sondern eine wiederkehrende Erfahrung unter bestimmten gesellschaftlichen und beruflichen Bedingungen.
Mythos 4: Burnout entsteht durch zu viel Arbeit.
Fakt: Burnout ist mehr als Überlastung. Die Forschung – u. a. das Job Demands–Resources Model (JD-R-Modell) von Demerouti, Bakker, Nachreiner und Schaufeli (2001) – zeigt: Burnout entsteht oft durch ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen. Hohe Anforderungen (z. B. Arbeitsmenge, Zeitdruck, Konflikte) sollten möglichst durch stärkende Ressourcen (z. B. soziale Unterstützung, Handlungsspielraum, Anerkennung) ausgeglichen werden. Es ist also nicht nur die Quantität der Arbeit entscheidend, sondern auch deren Qualität, Sinnhaftigkeit und Gestaltbarkeit.
Was wirklich bei der Burnout-Prävention hilft
Burnout entwickelt sich meist über längere Zeit – umso wichtiger ist es, frühzeitig gegenzusteuern. Dabei gilt: Es gibt keine universelle Lösung, aber viele wirksame Strategien. Grundsätzlich lassen sich präventive Maßnahmen in zwei Bereiche gliedern:
- Belastungen reduzieren
- Energie aufbauen und erhalten
- Belastungen reduzieren
- Selbstmanagement und Priorisierung: Bei hoher Aufgabenlast hilft ein klares System – etwa mit A-, B-, C-Listen: Was ist wirklich wichtig und dringend (A)? Was ist mittelwichtig (B)? Was kann warten oder gestrichen werden (C)? Wichtig ist: Nicht alles, was reinkommt, muss auch sofort erledigt werden.
- Klare Zeitfenster: Aufgaben brauchen Räume. Blocken Sie sich für jeden Aufgabentyp Zeitfenster zum Erledigen. Es ist außerdem sinnvoll, Pufferzeiten einzuplanen – für Denkpausen, Übergänge, spontane Anliegen.
- Einstellung überprüfen: Perfektionismus, überhöhte Ansprüche oder das Bedürfnis, es allen recht zu machen, erhöhen den inneren Druck. Manchmal ist der eigene Anspruch das eigentliche Problem. Fragen Sie sich: Welche Erwartungen habe ich an mich selbst – und welche davon will ich bewusst ändern?
- Lernende Haltung: Wer regelmäßig reflektiert, kann besser gegensteuern. Hilfreiche Fragen: Wann bin ich besonders gestresst? Was tut mir gut? Welche Warnsignale tauchen bei mir zuerst auf (z. B. Schlafprobleme, Gereiztheit, Rückzug)?
- Rollenmodelle nutzen: Wer in Ihrem Umfeld wirkt ausgeglichener oder souveräner? Was könnten Sie sich abschauen? Burnout-Prävention ist kein Zeichen von Schwäche – sondern ein Ausdruck bewusster Selbstführung.
- Energiequellen pflegen
- Micropractices: Kleine Achtsamkeitsmomente im Alltag wirken wie Mini-Akkus. Beispiele: Drei bewusste Atemzüge beim Aufstehen vom Schreibtisch. Hände waschen mit voller Aufmerksamkeit auf das kühle Wasser. Einmal täglich für 60 Sekunden bewusst die Schultern lockern. Diese winzigen Rituale helfen, das Nervensystem zu beruhigen.
- Microbreaks: Kurze Pausen alle 60–90 Minuten erhöhen nicht nur die Produktivität, sondern schützen vor Erschöpfung. Entscheidend ist: Die Pause sollte bewusst genommen werden – bevor die ersten Warnzeichen auftreten. Auch ein kurzer Blick aus dem Fenster oder eine Runde um den Block kann helfen.
- Regeneration ernst nehmen: Guter Schlaf, gesunde Ernährung, Bewegung und Erholung sind keine „Nice-to-haves“, sondern Grundlagen für nachhaltige Leistungsfähigkeit. Wer dauerhaft Energie verbraucht, ohne sie aufzufüllen, steuert zwangsläufig auf ein Defizit zu.
Fazit: Burnout verstehen, statt vereinfachen
Burnout ist ein ernstzunehmender Zustand mit realen Folgen – aber auch mit vielen Missverständnissen. Es geht nicht um Schwäche, nicht nur um Stress, nicht nur um Überlastung. Sondern um eine chronische Erschöpfung, die entsteht, wenn Energie dauerhaft verbraucht wird, ohne sich regenerieren zu können. Wer Burnout wirklich verstehen will, muss differenzieren – und anfangen, über gesunde Arbeitskulturen zu sprechen.
Weiterführende Quellen:
- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309–328.
- Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. I. (2014). Burnout and work engagement: The JD–R approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 389–411.
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499
- DGPPN (2012). Positionspapier zum Thema Burnout.
- Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn‐out. Journal of Social Issues, 30(1), 159–165. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103–111
- WHO (2022). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics: Burn-out (QD85). https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281



